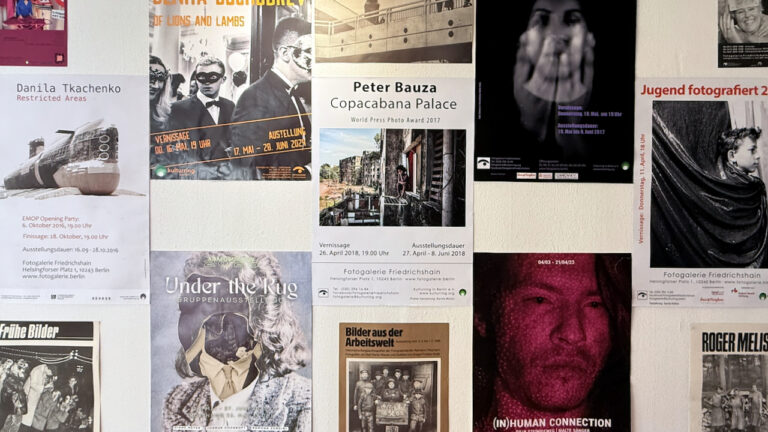Ein bisher eher wenig beachteter Aspekt der Aufarbeitung der NS-Zeit wird derzeit in einer Ausstellung im Deutschen Historischen Museum (DHM) thematisiert.
Unter dem Titel »Gewalt ausstellen« zeigt die Schau, wie in anderen europäischen Ländern direkt nach dem Krieg die Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes dokumentiert und öffentlich thematisiert wurden.
Sogar noch vor dem offiziellen Ende des Zweiten Weltkriegs eröffnete am 3. Mai 1945 in Warschau eine erste Ausstellung mit dem Titel »Warszawa oskarża« – auf Deutsch »Warschau klagt« an. Sie zeigte die nationalsozialistischen Verbrechen an der polnischen Bevölkerung, insbesondere die Zerstörung der Stadt und das Leid ihrer Bewohner.
Weitere Ausstellungen folgten in London, Paris und im tschechischen Liberec. In London wurden erstmals Fotografien aus befreiten Konzentrationslagern öffentlich gezeigt – mit starker Bildsprache und emotionaler Wucht, die auch bewusst genutzt wurde, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Der Besucherzuspruch war dementsprechend groß.
Jetzt zum Newsletter anmelden!
Jeden Donnerstag handverlesene Tipps zum Wochenende
Die Ausstellungsmacher jener Zeit verfolgten nicht nur das Ziel, zu dokumentieren oder zu erinnern. Viele wollten auch Einfluss nehmen – politisch, moralisch oder kulturell. Dabei dominierten oft nationale Narrative, Widerstandserzählungen oder kommunistische Perspektiven. Die spezifische Verfolgung und Ermordung der Jüdinnen und Juden wurde in vielen dieser frühen Ausstellungen nicht besonders hervorgehoben.
Erst in späteren Präsentationen – etwa 1948 erneut in Warschau – rückte die jüdische Perspektive stärker in den Vordergrund. Auch eine besondere Ausstellung, die 1947 im Displaced Persons Camp Bergen-Belsen gezeigt wurde, setzte hier ein Zeichen.
Nach der Befreiung im April 1945 wurde das ehemalige Konzentrationslager nicht einfach geschlossen. Die britische Armee nutzte das Gelände zunächst als Quarantänestation für die überlebenden Häftlinge. In unmittelbarer Nähe entstand wenig später ein sogenanntes Displaced Persons Camp. Dort lebten zeitweise bis zu 12.000 jüdische Überlebende. Sie organisierten eine Ausstellung, die ihre eigene Perspektive auf die Shoah, die kulturelle Zerstörung und das Leben nach der Befreiung zeigen sollte.
Die Schau im DHM bietet interessante Einblicke und zum Teil neue Perspektiven auf das vielschichtige Erinnern und Aufarbeiten dieses dunkelsten Kapitels der deutschen Geschichte – ein Thema, mit dem man sich auch 80 Jahre nach Kriegsende immer wieder neu auseinandersetzen sollte.
Noch bis zum 23. November ist die Ausstellung im Erdgeschoss des Pei-Baus zu sehen. Der Eintritt kostet 7 €.